 |
 |
|
Sicherlich
ging es fast allen Lauterbachern wie dem Rest der Welt:
Jahrzehnte lang war er einem gänzlich unbekannt, am
nächsten war er auf allen Titelblättern:
Der ehemalige Schüler des Lauterbacher
Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Professor Peter
Grünberg.
Peter Grünberg ist es zu verdanken, dass auf kleinstem
Raum immer mehr Daten gespeichert werden können. "Alle,
die mit einem Laptop herumlaufen, sollten ihm dankbar
sein", sagte Börje Johansson, Mitglied des
Physik-Nobelkomitees.
Der neue Physik-Nobelpreisträger Peter Grünberg hat
Entscheidendes für die Revolution der Computertechnik
geleistet: Bereits in den 80er-Jahren entdeckte er den
Riesenmagnetwiderstand (GMR). Der GMR-Effekt brachte den
Durchbruch zu Giga-Byte-Festplatten. Dieser ermöglichte
es, die Speicherkapazität von Computern zu erhöhen und
den Lesevorgang zu beschleunigen.
Ohne die Entdekung des GMR-Effekts wäre beispielsweise
die Entwicklung der heutigen MP3-Player nicht möglich
gewesen. |
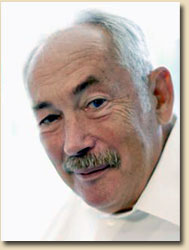 |
|
|
„Die Entwicklung
von Computern in den letzten Jahren hat gezeigt, dass dies ein
wichtiger Beitrag war“, sagte Grünberg dem schwedischen
Fernsehsender TV4. Mit der Zunahme der Datenmenge müssen
gespeicherte Informationen auf immer engeren Raum
zusammenrücken. Die Daten können nur abgerufen werden, wenn sie
von Magnetfeldsensoren gelesen werden. Die Menge an
gespeicherter Information kann also wesentlich gesteigert
werden, wenn die Sensoren verbessert werden. Genau das hat die
Arbeit von Grünberg und des Franzosen Albert Fert, mit dem sich Grünberg den Preis
teilt.
Grünberg bezeichnete die Verleihung des Nobelpreises als „große
Ehre“. Eine Sprecherin des Forschungszentrums Jülich bei Aachen
sagte am Dienstag, der Wissenschaftler sei gegen 11.35 Uhr in seinem
Büro vom Nobelpreiskomitee angerufen worden. Obwohl er emeritiert
ist, war er am Morgen in Erwartung der Entscheidung extra ins Büro
gekommen: „Wir warten da ja irgendwie seit fünf Jahren drauf“, sagte
die Sprecherin. „Herr Grünberg ist ein sehr ruhiger, bedächtiger
Mensch, aber er freut sich sehr.“ Nach der Entgegennahme erster
Glückwünsche habe sich der 68-Jährige zunächst zurückgezogen, um
etwas zu essen und sich auszuruhen: „Er ist ja nicht mehr der
Jüngste.“
Nach dem Telefonat stieß Grünberg mit seinen Kollegen an. „Wir
hatten noch zwei Flaschen Sekt unserer Hausmarke von der letzten
Feier im Kühlschrank“, sagte Schinarakis. „Champagner gab’s nicht.“
Grünberg dankte seinen Mitarbeitern und unterstrich, dass mit dem
Preis eine „Teamleistung“ ausgezeichnet werde. Grünberg war seit
Jahren für den Nobelpreis gehandelt worden, doch nach Angaben von
Schinarakis hatte der Forscher selbst nicht so recht daran geglaubt:
„Wer glaubt schon an den Nobelpreis?“
Grünberg wurde bereits vielfach international ausgezeichnet. 2004
ist er beim Forschungszentrum Jülich offiziell nach 32 Jahren in den
Ruhestand gegangen. Sein Kollege Fert hielt damals den Festvortrag.
Grünberg ist aber laut Forschungszentrum weiter wissenschaftlich
tätig.
Peter Andreas Grünberg ist gebürtiger Tscheche. Er wurde am 18. Mai
1939 in Pilsen als Sohn eines Diplomingenieurs geboren. Die Familie
siedelte nach dem Krieg nach Lauterbach in Hessen um. Dort besuchte
Grünberg das Realgymnasium. Er begann sein Physikstudium in
Frankfurt am Main, setzte es in Darmstadt fort und schloss es 1969
mit der Promotion ab.
Zunächst forschte er drei Jahre an der kanadischen Universität in
Ottawa. 1972 kam er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts
für Festkörperforschung (IFF) zum Forschungszentrum Jülich. Dort
untersuchte er „mikroskopische Sandwiche“, laut Forschungszentrum
Systeme aus zwei magnetischen Eisenschichten, die von einer nur
wenige Atomlagen dünnen, nichtmagnetischen Schicht aus Chrom
getrennt werden. Seine Entdeckung des Riesenmagnetwiderstands ließ
er 1988 patentieren. Sie fand ungewöhnlich schnell Einzug in die
industrielle Anwendung. Der GMR-Effekt wird seit Mitte der
90er-Jahre in allen gängigen Festplatten genutzt, um magnetische
Bits und Bytes auszulesen.
Grünberg wurde 1992 zum Außerplanmäßigen Professor an der Kölner
Universität ernannt. Er wurde mit hohen Preisen geehrt, teilweise
gemeinsam mit seinem Kollegen Fert, darunter der Deutsche
Zukunftspreis des Bundespräsidenten und der
Manfred-von-Ardenne-Preis für Angewandte Physik der Europäischen
Forschungsgemeinschaft Dünne Schichten.
Die Europäische Kommission und das Europäische Patentamt zeichneten
Grünberg im vergangenen Jahr als „Europäischen Erfinder des Jahres“
aus. In diesem Jahr hat Grünberg die Stern-Gerlach-Medaille der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft, den Japan-Preis sowie
gemeinsam mit Fert den israelischen Wolf-Preis erhalten.
Grünbergs Frau Helma – das Paar ist seit 1966 verheiratet und hat
drei Kinder – hat sich ebenfalls für die Wissenschaft engagiert. Sie
war viele Jahre im Vorstand des Internationalen Clubs in Jülich und
hatte von 1999 bis 2003 den Vorsitz. Sie habe besonders den Familien
von Wissenschaftlern beim Einleben geholfen, kulturelle und
informative Veranstaltungen organisiert, teilte das
Forschungszentrum mit. So habe sie die Brücke zwischen Menschen
verschiedener Kulturen geschlagen.
Peter Grünberg verstarb am
7. April 2018 |